Die Vergütung von Anwälten erfolgt nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Dieses Gesetz besteht aus einem allgemeinen Teil sowie einem Vergütungsverzeichnis (VV RVG), in dem die jeweiligen Gebühren in Abhängigkeit vom Tatbestand geregelt sind. Für Pflichtverteidiger gelten grundsätzlich dieselben Vergütungssätze wie für alle anderen Anwälte, allerdings gibt es einige Besonderheiten.
So entsteht der Gebührenanspruch beim Pflichtverteidiger
Bei strafrechtlichen Prozessen wird die Vergütung eines Anwaltes entweder aus der Staatskasse oder vom Beschuldigten gezahlt. Wer die Verfahrenskosten trägt, entscheidet das Urteil. Beim Freispruch bezahlt der Staat, bei einer Verurteilung der Verurteilte. Wird bei einer notwendigen Verteidigung nach § 140 StPO ein Pflichtverteidiger durch das Gericht beigeordnet, bildet dieser richterliche Beschluss die Grundlage des Gebührenanspruchs. Die Anwaltskosten übernimmt im ersten Schritt die Staatskasse. Unerheblich ist dabei, ob der Beschuldigte mit der Beiordnung einverstanden war oder nicht und ob eine Vollmacht für den Pflichtverteidiger erteilt wurde.
Wie wird vergütet?
Welche Vergütung der Pflichtverteidiger erhält, ist vom Umfang der Bestellung abhängig. Diese kann auf einzelne Verfahrensteile beschränkt werden. Generell gilt, dass ein Pflichtverteidiger ebenso wie der Wahlverteidiger sein Honorar nach den Regelungen des RVG erhält, allerdings ist der Gebührenanspruch nach oben hin beschränkt. Unabhängig davon, in welchem Umfang er als Anwalt für den Beschuldigten tätig ist, beträgt seine Gebühr 80 % der Mittelgebühr (Mindestgebühr + Höchstgebühr : 2) eines Wahlverteidigers. Zusätzlich zur Anwaltsgebühr kann der Pflichtverteidiger Auslagen geltend machen, hier gelten die Allgemeinen Regelungen aus dem Teil 7 VV RVG.
Für Grundgebühr und Verfahrensgebühren gelten für Pflichtverteidiger keine besonderen Regelungen – auch hier ist die Höchstgebühr auf 80 % beschränkt. Hinsichtlich der Termingebühren gibt es allerdings einen Längenzuschlag zur Termingebühr. Den kann der Pflichtverteidiger abrechnen, wenn die Hauptverhandlung eine bestimmte Dauer überschreitet.
Zusätzliche Vereinbarungen mit dem Mandanten
Der Pflichtverteidiger darf zusätzlich zu seinem Gebührenanspruch nach VV RVG auch Zusatzvereinbarungen mit dem Mandanten treffen. Entscheidend dabei ist allerdings, dass der Beschuldigte sich freiwillig auf eine zusätzliche Vergütungsvereinbarung einlässt. Voraussetzung dafür ist, dass er über die Lage hinsichtlich der Gebührenordnung im Bilde ist. Der Pflichtverteidiger hat hier eine Aufklärungspflicht. So muss er den Beschuldigten zum Beispiel darüber informieren, dass dieser nicht verpflichtet ist, eine Vergütungsvereinbarung mit seinem Pflichtverteidiger zu treffen. Auf keinen Fall darf auf den Mandanten Druck ausgeübt werden. Dies wird zum Beispiel angenommen, wenn die Vergütungsvereinbarung direkt vor der Hauptverhandlung vorgelegt wird.
Eine Vergütungsvereinbarung darf nicht getroffen werden, wenn der Anwalt über die Prozesskostenhilfe beigeordnet wurde! Dieser Fall kann auf Nebenkläger oder Verletzte, die zur Nebenklage berechtigt sind, zutreffen.
Vergütung Wahlverteidiger als Pflichtverteidiger
Lässt sich ein Wahlverteidiger als Pflichtverteidiger beiordnen und gibt es eine Vergütungsvereinbarung aus der Zeit des Wahlmandates, dann sind zwei Aspekte wichtig:
- Der Verteidiger erhält die Vergütung eines Pflichtverteidigers.
- Die Zusatzvereinbarung gilt nur bis zur Beiordnung, als Pflichtverteidiger muss der Anwalt eine neue Vereinbarung mit dem Mandanten treffen.
Nach § 48 Abs. 6 Satz 1 RVG rechnet ein Pflichtverteidiger, der anfangs als Wahlanwalt für den Beschuldigten tätig war, sämtliche Gebühren und Auslagen – auch die aus seiner Zeit als Wahlverteidiger – über die Staatskasse ab. Diese Regelung gilt nicht, wenn die Beiordnung zum Pflichtverteidiger erst im Berufungs- oder Revisionsverfahren erfolgt.
Zahlungspflicht des Mandanten
Der Pflichtverteidiger kann nach § 52 RVG auch ohne Vertragsverhältnis zum Mandanten diesem gegenüber Gebühren abrechnen. Einen Vorschuss darf er allerdings nicht verlangen. Grundsätzlich gilt, dass die Anwaltskosten zu den Verfahrenskosten zählen und die trägt entweder der Beschuldigte bei einer Verurteilung oder die Staatskasse bei einem Freispruch. In der Praxis bezahlt auf jeden Fall erst einmal die Staatskasse die Anwaltsgebühr und fordert diese dann wieder vom Verurteilten ein. Im Jugendstrafverfahren wird oft auch die Rückzahlung der Verfahrenskosten verzichtet, gesetzliche Grundlage ist der § 74 Jugendstrafgesetz „Kosten und Auslagen“. Dort heißt es: „Im Verfahren gegen einen Jugendlichen kann davon abgesehen werden, dem Angeklagten Kosten und Auslagen aufzuerlegen.“


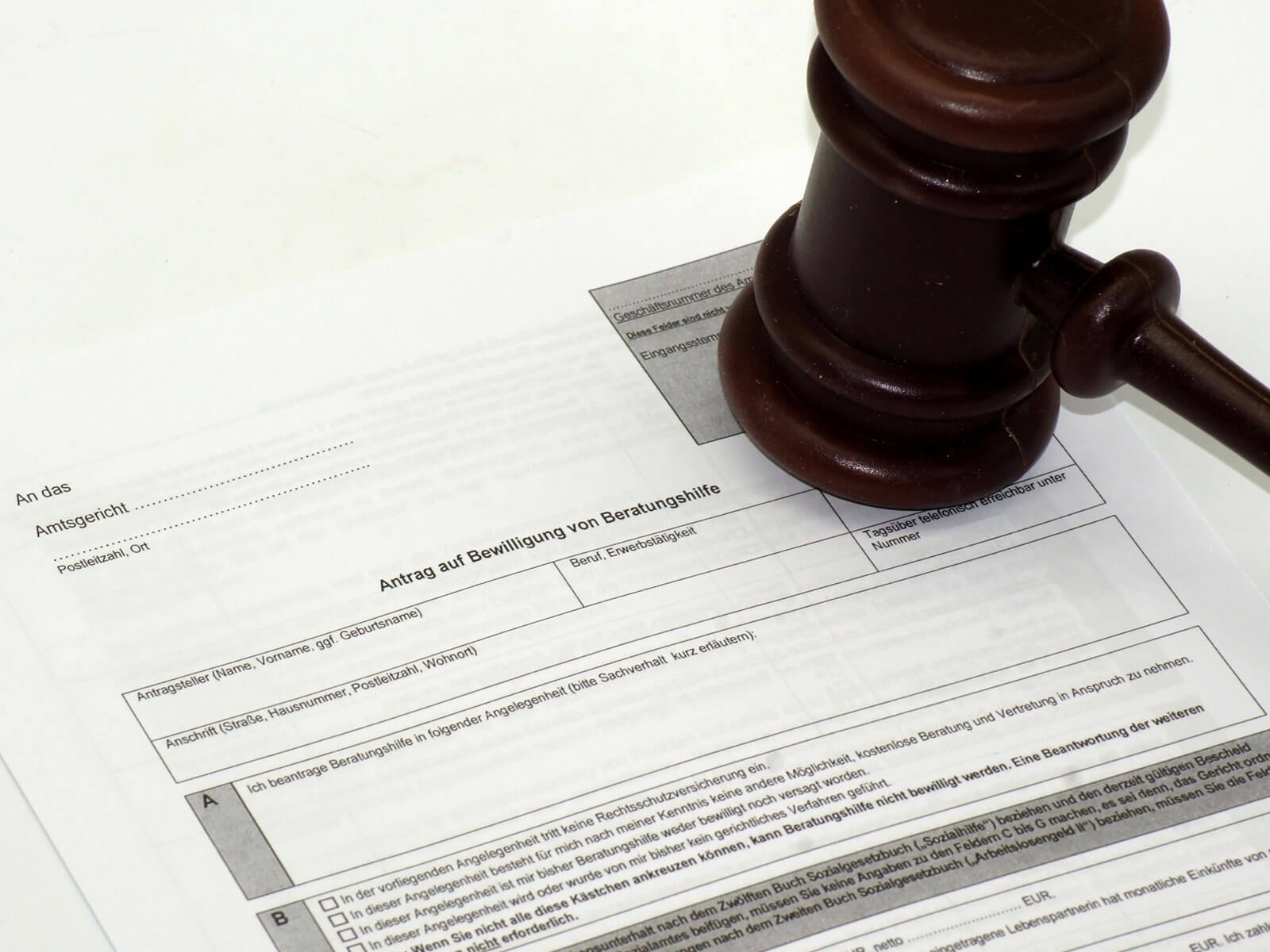

Soziale Medien